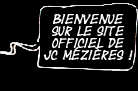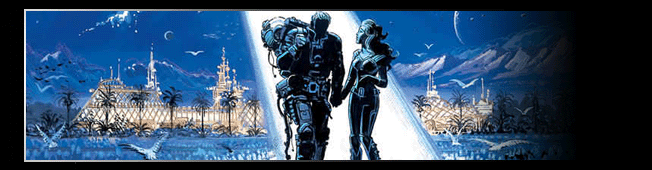

ARTICLE
|
Frankfurter Rundschau, Oktober 2000 Die Frankfurter Buchmesse widmet dem Comic erstmals eine ganze Halle.
Richtig anerkannt ist die
"neunte Kunst" in Deutschland aber immer noch nicht.
In Frankreich dagegen lesen Soziologen wie Pierre Bourdieu
und Philosophen wie Michel Serres die Bildgeschichten.
Der französische Comic-Szenarist Pierre Christin erklärt, warum das so ist.
Comics sind in diesem Oktober in Frankreich fast allgegenwärtig. Die große
"Bibliothek François Mitterrand" in Paris zeigt eine prestigereiche Ausstellung der ?bande dessinée?, wie die Bildgeschichten auf französisch heißen. Im neuen (und wunderschönen) Parc de Bercy gleich gegenüber auf der anderen Seite der Seine ist ein Fußweg mit Comic-Bildern illustriert, und in vielen Pariser oder anderen französischen Museen sind Originalzeichnungen zu sehen. Comic-Alben dienen auch als Vorlagen für erfolgreiche Theaterstücke, das seriöse Radioprogramm France Culture widmet dem Thema umfangreiche Sendungen. Die Buchhandlungen in Frankreich reservieren den Comic-Neuerscheinungen trotz des nervtötenden Wettlaufs um die Literaturpreise beste Regalplätze, und in den Studienplänen vieler Universitäten stehen für das Fach
"Kommunikationswissenschaften" die Comics an vorderer Stelle.
Nicht zu reden von den französischen Intellektuellen, die seit langem jede Allgemeinverurteilung der Comics tunlichst vermeiden. Der Philosoph Michel Serres beispielsweise hat sich als leidenschaftlichen Tintin-Experten bezeichnet, der ehemalige Präsidentenberater Jacques Attali hat mit dem Zeichner Philippe Druillet für ein Buch zusammengetan. Und der große Soziologe Pierre Bourdieu hat Jean-Claude Mézières um Mitarbeit an den ersten Ausgaben seiner Zeitschrift Actes de la Recherche en Sciences Sociales gebeten. Und nicht zu vergessen das rituelle Ereignis im Januar, der Comic-Salon in Angoulême, der — in seinem Fach — eine internationale Bekanntheit erreicht hat wie sonst nur die Frankfurter Buchmesse.
Welch ein Kontrast zur Situation des Comics in anderen Ländern ! Schon allein das Wort
"Comic" ist, im Vergleich zur französischen "Bande dessinée", negativ vorbelastet und verweist das Genre in den Bereich regressiver Kinderei. Das erklärt auch die Stellung der kleinen Comic-Läden in den USA : gleich neben oder sogar etwas unter dem Niveau von Sexshops. In Englands öffentliche Bibliotheken, wo das Wissen wohlgeordnet in Regalen aufgereiht ist, verirren sich nur wenige Comic-Alben. Wenn doch, liegen sie dort häufig in einer Ecke oder sind bunt gemischt mit allerlei Werken, die als einziges gemeinsames Merkmal verbindet, dass sie
"out of size", also zu groß sind und nicht ins Regal passen.
Trotz einer großen grafischen Tradition in Spanien verschafften die in Kiosken verkauften Bilderwerke Künstlern wie Carlos Gimenez keine Karriere in der Avantgarde-Bewegung
"Movida". Erwähnt man im Mittleren Osten, dass man gleichzeitig Comic-Autor und Universitäts-Professor ist, erntet man bestenfalls Misstrauen, schlimmstenfalls Gelächter. In Japan wird die mächtige
"Manga"-Industrie zweifelsohne weniger von Kreativität als von Produktivität getragen. Und in Deutschland bleibt meiner Ansicht nach noch einiges zu tun, bis Comics zum anerkannten Bestandteil der Kulturlandschaft werden — trotz der Leistungen eines bedeutenden Comic-Experten wie Andreas Knigge in Hamburg in den 80er Jahren, trotz des großen Erfolgs eines Erlanger Comic-Salons und trotz der Existenz junger Zeichner, denen eine große Zukunft gewiss ist.
Warum aber ist die Situation in Frankreich so anders, warum räumt man einem Genre, das viele hier wie dort im besten Fall noch als eine Art Kunstgewerbe durchgehen lassen, einen bevorzugten Platz ein ? Da wäre zunächst einmal zu klären, was heute eigentlich als bildende Kunst gelten darf. Die Malerei ? Die Bildhauerei ? Die Fotografie ? Das Design ? Die Mode ? Über die oft spekulativen finanziellen Investitionen, willkürliche Museumspraktiken und die Effekte gut inszenierter Medienkampagnen hinaus können alle diese — durchaus ehrenwerten — Bereiche kreativen Schaffens kaum eine moralische oder ästhetische Überlegenheit vorweisen, die nicht mit Klassendenken oder wirtschaftlichen Interessen zusammenhinge.
So gesehen präsentieren sich Comics in vieler Beziehung als Genre niederer Herkunft — ausgerichtet auf eine kindliche Leserschaft, einer populären Presse verbunden und weit entfernt von den formalistischen Ansprüchen mancher Avantgarden. Gleichzeitig sind sie an bildliche Darstellung und erzählerische Linearität gebunden und werden überdies meist von Autoren der weniger privilegierten sozialen Schichten verfasst. Comics sind daher eher jenen Ausdrucksformen zuzurechnen, denen der Schritt zu allgemeiner Anerkennung gerade erst oder noch nicht ganz gelungen ist. Denn mehr Berührungspunkte als mit den bildenden Künsten hat der Comic mit dem Jazz, dem Rock, dem Rap, dem Reggae oder dem Raï. Diese mehr oder weniger neuen Musikrichtungen, die aus den Vorstädten stammen und in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen wie in einem französischen Fußballteam, stehen der Welt des Comics viel näher als das Milieu der Kunstgalerien oder Verkaufshallen. Dem Comic verwandt ist auch die sogenannte
"schlechte" Literatur : Krimis, Science-fiction, Fantasy, in gewissem Maß auch Erotik, und — noch tiefer in der Rangordnung — der Humor. Nicht zu vergessen natürlich das Kino. In Frankreich, diesem kleinen Paradies der dunklen Säle, sind junge und weniger junge Comic-Autoren gewissermaßen alle Kinder des Kinos, seiner Bilder, seiner Dialoge, seiner Darsteller.
In der
"Bande dessinée" kommt also vieles zusammen. Nicht etwa um eine Subkultur oder eine Para-Literatur zu bilden, wie man in den 70er Jahren glauben konnte, sondern als echtes Substrat der Moderne. Es ist ein Ausdrucksmittel derer, die etwas zu sagen haben über ihre Welt, über die Welt, in der sie leben, hic et nunc. Das Universum der Comics ist nicht Teil der als etwas erdrückend empfundenen Welt einer
"hohen Kultur", in der man bereits als "großer Künstler"
gilt, wenn man die Meinungsmacher hinter sich, aber sonst kein Publikum hat. Ein Comiczeichner dagegen wird nur dann berühmt, wenn er Persönlichkeiten geschaffen hat, die von unzähligen treuen Lesern geliebt werden.
Aber es gibt noch weitere Besonderheiten, die diese französische oder genauer gesagt frankobelgische Ausnahme erklären. Zunächst hatte das Genre den historischen Vorteil, von Menschen geschaffen zu werden, die zugleich allgemeingültige Grundregeln für ihre Zunft wie ihr persönliches Werk entwickelten : Hergé schuf mit Tintin die Welt der Gutgesinnten, Franquin erfand mit Gaston den ätzenden Humor und Charlier mit Blueberry die realistische Linie. Goscinny erfand nicht nur Asterix, sondern öffnete sein Journal Pilote in den 60er Jahren auch zahllosen jungen Zeichnern und ermutigte sie, sich in eigenem Stil auszudrücken — von Giraud über Fred, Gotlib, Claire Brétecher bis hin zu Tardi und so vielen anderen.
Zudem bietet Frankreich — traditionell, wenn man so sagen darf — etwas mehr Durchlässigkeit als andere Länder zwischen anspruchsvoller und populärer Kultur, zwischen erhabenen und niedrigen Genres. Marcel Duchamp schuf als Erster aus trivialsten Dingen Kunstwerke. Gide erkannte die literarische Fruchtbarkeit Simenons an und beneidete ihn sogar ein wenig darum. Sartre und Beauvoir lasen Détective, eine nicht eben vornehme bunte Illustrierte. Und in Frankreich konnte ein sozialistischer Kulturminister wie Jack Lang ab 1981 populären Kunst-Aktionen von mehr oder weniger großem Erfolg (aber hier liegt das Problem ja nicht) sozusagen Aufenthaltsgenehmigungen in der Kultur — und Bildungsszene des Landes erteilen. Damit ist ein ehemals verrufenes Unterhaltungsgenre wie der Comic für viele Lehrer oder Bibliothekare zum letzten Bollwerk des Lesens in einem von der (wirklichen oder vermeintlichen) Analphabetisierung seiner Jugend aufgeschreckten Land geworden. Im Grunde ein willkommener Zusammenschluss ehemaliger Feinde.
Aber auch im Reich der
"Bande dessinée" ist nicht alles rosig. Auch wenn die Verlage gleichbleibend hohe Mengen produzieren (bis zu 800 Titeln pro Jahr, was enorm ist), sind Misserfolge vermutlich häufiger als Erfolge. Der Markt ist instabil, umso mehr, als die Alben teuer produziert, aber billig verkauft werden, was den Verlagen eine reduzierte Gewinnspanne und im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten lässt : Entweder haben sie ein paar wiederkehrende erfolgreiche Helden oder sie erhöhen die Zahl der Titel. Beide Strategien bergen Risiken unterschiedlicher Natur. Zu beobachten ist diese Entwicklung bei Comicserien wie XIII oder Largo Wynch, die sich nicht ohne Geschick der Mittel bewährter Bestseller-Autoren wie den amerikanischen
"Techno-Writers" bedienen. Aber um ein jugendliches Publikum zurückzugewinnen, das zuweilen vom extrem hohen Anspruch künstlerischer Alben abgeschreckt wird, ist die Versuchung auch groß, auf die bewährten Werte des Comics zurückzugreifen : große Nasen, große Busen, große Knarren, billige Erotik und Esoterik. Das wäre an sich nichts Schlimmes, kann aber dazu führen, den Comic wieder in das Getto zurückzuwerfen, das er nur mit Mühe verlassen hat.
Aber das ist noch etwas anderes, etwas wesentliches, was die Comic-Szene in Frankreich von anderen unterscheidet. Es gibt so etwas wie eine
"französische Schule von Zeichnern" — talentiert, vielseitig und immer in Erneuerung. Wo sich junge Künstler in anderen Ländern für die Malerei, die Installation, die Illustration, die Dekoration, die Werbung oder was weiß ich entscheiden, wenden sich in Frankreich früher wie heute einige der begabtesten unter ihnen spontan dem Comic zu. Einem Genre, das, wenn es auch (außer für eine Handvoll Stars) nicht wirklich lukrativer ist, einen enormen Freiraum zu bieten scheint. Immer neue Namen stehen für ein sich ständig erneuerndes grafisches Schaffen : André Julliard, Max Cabanes oder François Boucq für die Meister der Zeichenkunst, Franck Margerin, Florence Cestac oder Lewis Trondheim für das komische Fach und ein Enki Bilal für ein rundum mustergültiges Werk.
Diese großen Preisträger von Angoulême sollen hier noch einmal erwähnt werden, um daran zu erinnern, dass diese im bemerkenswerten Gegensatz zu den berühmten französischen Literaturpreisträgern praktisch nie umstritten sind — so offensichtlich ist ihre herausragende Qualität für alle. Denn auch das ist die kulturelle Besonderheit des Comics : Er ist eine der ganz seltenen Literaturformen für jedes Alter, jede Klasse, die Vater und Sohn, Jung und Alt, gebildete Leser und Witzliebhaber, leidenschaftliche Originalsammler oder Mädchen, für die es sich nur um eine Erzählform unter anderen handelt, auf ganz außergewöhnliche Weise verbindet in einem Genre, das bei vielen eine wahre Passion à la française weckt.
|